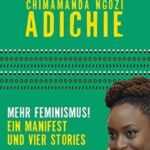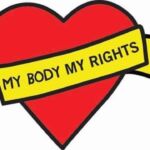Tag gegen Rassismus: Schutz vor Diskriminierung und Gewalt bleibt auch in Corona-Krise drängende Aufgabe
BERLIN, 20.03.2020 – Anlässlich des Tags gegen Rassismus am 21.
März erinnert die Menschenrechtsorganisation Amnesty International
daran, dass der Schutz vor Diskriminierung, Hassrede und
rassistischer Gewalt eine drängende gesamtgesellschaftliche
Aufgabe bleibt.
Tag gegen Rassismus: Schutz vor Diskriminierung und Gewalt bleibt auch in Corona-Krise drängende Aufgabe
Einen Monat nach dem rassistischen Anschlag von Hanau mahnt Amnesty International die deutschen Sicherheitsbehörden weiter an: Der Schutz vor Diskriminierung und rassistischer Gewalt ist eine Frage der inneren Sicherheit. Gleichzeitig bleibt die Zahl rassistischer Gewalttaten weiter hoch in Deutschland; diese Lage kann sich durch die Corona-Krise verschlechtern, die Ressentiments und Rassismus zu Tage bringt.
„Mit der Corona-Krise drohen wir zu vergessen: Der rassistische Anschlag von Hanau ist erst knapp einen Monat her. Rassismus und Menschenfeindlichkeit bedrohen, verletzen und töten Kinder, Frauen und Männer in Deutschland. Die Angriffe von Hanau oder auch Halle sind schreckliche Gewaltexzesse und gleichzeitig nur die Spitze eines Eisbergs täglicher Diskriminierung und rassistischer Angriffe auf unsere Nachbarn, unsere Kolleg_innen oder uns und unsere Kinder“, sagt Markus N. Beeko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland.
Rassistisch motivierte Straftaten haben laut Zahlen des Bundeskriminalamts 2018 (7701 Fälle) im Vergleich zu 2017 (6434) um etwa 19 Prozent zugenommen. Ähnlich sieht es im Bereich antisemitischer Strafteten aus mit 1799 Fällen im Jahr 2018 und 1504 im Jahr 2017 (plus etwa 16 Prozent), knapp 90 Prozent ordnen die Behörden dem rechten Spektrum zu.
„Der Schutz vor Rassismus und Diskriminierung ist ein Menschenrecht und eine Frage der inneren Sicherheit“, so Beeko. „Es war überfällig, dass die Sicherheitsbehörden und der Generalbundesanwalt ihre Bemühungen verstärkt haben. Wie wir diese Woche im Vorgehen gegen sogenannte ‚Reichsbürger‘ gesehen haben, ist es weiterhin dringend notwendig, dass der Rechtsstaat angemessen und konsequent organisierte rassistische Strukturen bekämpft.“
Nicht nur der Staat, sondern wir alle sind gefragt
„Bundespräsident Steinmeier hat diese Woche zu Recht in einem Interview betont, dass der Einsatz gegen Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Solange Menschen in unserem Land Angst haben müssen, beschimpft, bedroht und angegriffen zu werden, weil sie eine Kippa oder ein Kopftuch tragen, wegen der Farbe ihrer Haut oder wegen der Sprache, die sie sprechen, sind wir alle gefordert“, so Beeko. „Es braucht eine Ausweitung und konsequentere Umsetzung des Nationalen Aktionsplans gegen Rassismus. Es braucht langfristige Menschenrechtsbildung für unsere Kinder und Enkel und es braucht von uns allen Achtsamkeit und Zivilcourage im Alltag.“
Bundespräsident Steinmeier hatte in einem Interview bei T-Online Anfang der Woche betont: „Jeder Einzelne muss widersprechen, wenn er rassistische Sprüche am Stammtisch oder im Fußballstadion hört. Denn darauf gibt es nur eine Antwort: ‚Wenn das deine Haltung ist, passt du hier nicht rein‘. Ich weiß, was ich erwarte, ist schwer. Aber es ist notwendig.“
Diskriminierung in Corona-Zeiten entgegentreten
„In Krisen-Zeiten, wie einer Corona-Pandemie, zeigen sich Stärke und Solidarität einer Gesellschaft. Dazu gehört, wie sie für besonders Schutz- und Hilfsbedürftige sorgt, aber auch, wie sie jeder Ausgrenzung und Diskriminierung entgegentritt“, sagt Beeko. Medien hatten berichtet, wie in zahlreichen Fällen beispielsweise Menschen, von denen angenommen wurde, sie kämen aus China, beleidigt, angegriffen und verletzt wurden.
Nährboden für rassistische Einstellungen und Gewalt
Ein in dieser Woche erschienener Bericht der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) des Europarats bescheinigt Deutschland auch für 2019 einen weiter zunehmend rassistischen Diskurs in der Öffentlichkeit. „Wenn Menschen in Medien und gesellschaftlichen Debatten diffamierend dargestellt, abgewertet und ausgegrenzt werden, seien sie nun Menschen jüdischen Glaubens, Muslime oder Flüchtlinge, ist das der Nährboden für rassistische Einstellungen und Gewalt“, erinnert Beeko.